PDF-Version
Neues aus der Forschung
Mutationen sind nicht so zufällig verteilt wie angenommen
Neue Forschungsergebnisse verändern unsere Sicht auf die Evolution
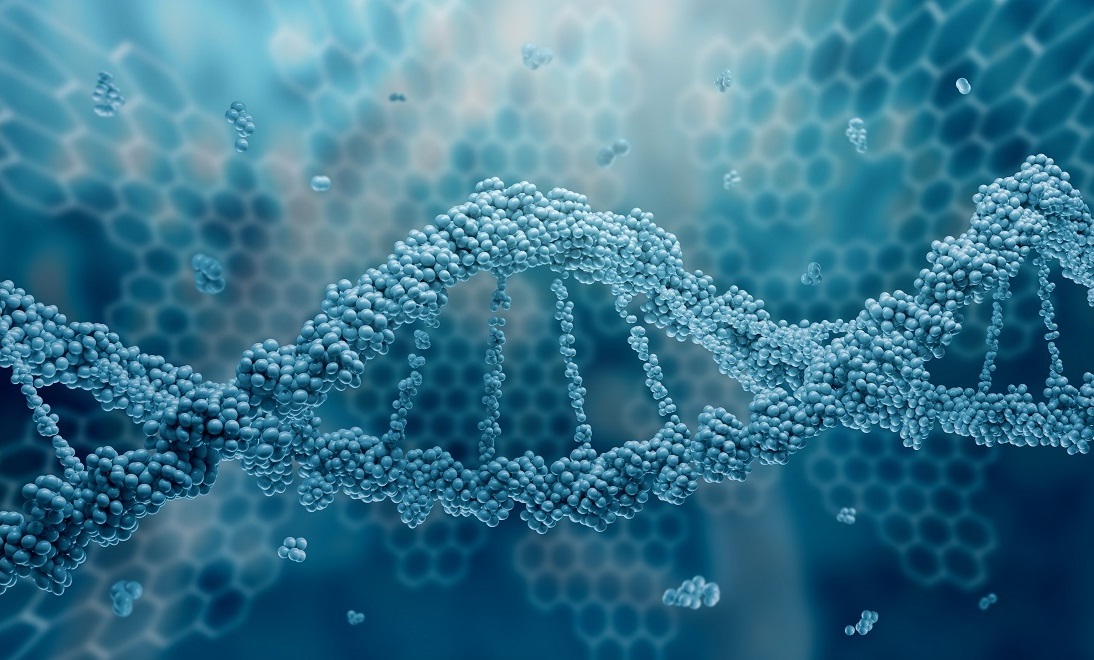
Mutationen sind insofern zufällig, als sie unabhängig davon auftreten, ob sie ihrem Träger nützen oder schaden. Doch eine Forschungsstudie rückt diese Jahrzehnte alte Annahme jetzt in ein neues Licht. So lieferte die Auswertung von tausenden Veränderungen im Genom der Acker-Schmalwand einen unerwarteten Befund: Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Mutation ist dort höher, wo sie statistisch nützlicher ist. Das liegt daran, dass Gene, die für schädliche Mutationen besonders anfällig sind, seltener mutieren als andere DNA-Bereiche. Umgekehrt ist die Mutationsrate an Stellen des Erbguts höher, wo eine größere Chance auf nützliche Veränderungen besteht. Die in der Zeitschrift Nature veröffentlichten Ergebnisse haben interessante Konsequenzen für die Evolution.
Mutation bias: Genetische Veränderungen sind nicht gleichverteilt
In der Fachwelt ist seit langem bekannt, dass nicht alle DNA-Abschnitte gleich häufig von Genmutationen betroffen sind. So ist zum Beispiel die Mutationsrate in Regionen des Erbguts, in denen sich die DNA-Basenabfolge "Cytosin-Guanin" häufig wiederholt (so genannte CG-Inseln), höher als in den übrigen. Zudem sind nicht alle Punktmutationen gleich wahrscheinlich: DNA-Basen werden häufiger gegen strukturverwandte Basen ausgetauscht als gegen solche, mit denen sich der chemische Charakter der Base ändert: Eine Purinbase (Adenin, Guanin) wird bevorzugt durch die andere Purinbase ersetzt; analoges gilt für die Pyrimidinbasen.
Das Phänomen, dass unter dem Einfluss physikalisch-chemischer Prozesse bestimmte Genmutationen häufiger auftreten und manche Erbgutabschnitte rascher mutieren als andere, bezeichnen Genetiker als mutation bias (von englisch "bias": Verzerrung, Abweichung von der Gleichverteilung). Gelehrt wird das seit Jahrzehnten. Neu ist hingegen die Erkenntnis, dass die Mutationshäufigkeiten in Abhängigkeit von den durch Mutationen zu erwartenden Schäden und Vorteilen variieren.
Die Mutationsrate steht im Zusammenhang mit der Funktion der Gene
Diese Erkenntnis hatte die Standard-Evolutionstheorie nicht auf dem Schirm. Ihr kamen Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Biologie von der Universität Tübingen und der University of California auf die Spur. Die Forschergruppe um Prof. Detlef WEIGEL, Direktor der Abteilung Molekularbiologie, und Grey MONROE, Assistenzprofessor am Department of Plant Sciences, züchtete hunderte von Exemplaren der Acker-Schmalwand (Arabidopsis thaliana) unter Bedingungen, die es zuließen, dass sich auch Pflanzen mit schädlichen Mutationen vermehrten (MONROE et al. 2022). So konnten die Wissenschaftler tausende von Mutationen nachweisen, die normalerweise unter dem Einfluss reinigender Selektion rasch wieder verschwinden würden.
Mithilfe statistischer Verfahren konnten die Autoren nachweisen, dass die Mutationen nicht unabhängig von der Funktion der jeweiligen Gene über das Genom verstreut waren. Gene, bei denen schädliche Veränderungen katastrophale Auswirkungen auf die Pflanze haben, waren kaum von Mutationen betroffen. Andere Genombereiche, wie etwa wie regulatorische DNA-Sequenzen, wo eine größere Chance auf nützliche Veränderungen besteht, zeigten sich dagegen "mutationsfreudiger".
DNA-Reparatur beeinflusst die Häufigkeit genetischer Veränderungen
Grund für die funktionsabhängige Variabilität der Mutationsraten sind epigenetische Veränderungen an bestimmten Erbgutabschnitten oder Stützproteinen der DNA. Sie steigern oder vermindern die Effektivität der Reparatur von DNA-Schäden.
Das Forscherteam fand zum Beispiel in häufig mutierten Bereichen des Erbguts höhere Anteile an Cytosin, das mit Methylgruppen versehen ist. Solche chemisch veränderten Cytosin-Bausteine begünstigen Genveränderungen. Des Weiteren finden sich an regulatorischen Regionen häufig DNA-Strukturen, die Reparaturenzyme behindern, was die Mutationsrate ebenfalls steigert. Lebensnotwendige Gene wiederum sind oft mit epigenetisch veränderten Histonen assoziiert, welche die Effektivität der DNA-Reparatur verbessern und dadurch die Mutationsrate drosseln.
Die Mutationsrate als Ergebnis evolutiver Anpassung: ein Mechanismus
Die Stabilisierung für das Überleben wichtiger Gene ist ein einleuchtender Überlebensvorteil. Sie verringert die genetische Bürde ("mutational load"), also die Gesamtheit der im Genom oder im Genpool einer Population "mitgeschleppten" schädlichen Gene. Die Steigerung der Mutationsrate in anderen Erbgutbereichen wiederum bringt den Evolutionsvorteil einer rascheren Anpassungsfähigkeit mit sich.
MONROE und Kollegen sprechen von "adaptive mutation bias". Sie meinen damit, dass die Selektion Veränderungen im Epigenom bevorzugt, die über eine verbesserte DNA-Reparatur lebensnotwendige Gene vor schädlichen Mutationen schützen und durch erhöhte Mutabilität in regulatorischen Bereichen die Anpassungschancen steigern.
Theoretisch könnte dies dazu führen, dass die Mutationsrate genspezifisch evolviert. Die Sache hat nur einen Haken: Der Selektionsdruck ist so schwach, dass dies nur in Organismen mit riesigen Populationen zu adaptiver Evolution führen würde. Ob das funktioniert, hängt auch von der Länge des Abschnitts ab, für den die Mutationsrate gesenkt werden soll. Da die betreffenden Gene über 200.000 Basenpaare (200 kB) lang sein müssten, wurde bislang davon ausgegangen, dass die Mutationsraten nicht genspezifisch evolvieren können. So lang sind normalerweise nämlich keine Gene.
Das Autorenteam präsentiert nun einen Mechanismus, mit dem Organismen auch bei kleiner effektiver Populationsgröße ihre Mutationsraten genspezifisch anpassen können: Im Zentrum ihrer Überlegungen stehen bestimmte Marker-Proteine, die sensitiv für Expressionsraten sind. Das heißt, diese Proteine "markieren" essenzielle Gene, indem sie an hoch exprimierte Sequenzen binden, also an stark abgelesene DNA-Abschnitte. Diese Marker rekrutieren (binden) wiederum DNA-Reparatur-Enzyme, wodurch dort die Mutationsrate sinkt. Tritt nun eine Mutation ein, die diese Rekrutierung verstärkt, beeinflusst dies dutzende Gene gleichzeitig, sodass die erwähnte Mindestlänge der Gene von 200 kB keine Rolle mehr spielt.
Optimierte Mutationsraten erleichtern die Entstehung von Innovationen
Für die Evolutionstheorie sind die Erkenntnisse der neuen Studie in zweierlei Hinsicht bedeutsam: Zum einen zeigt sich, dass schädliche Mutationen nicht allein durch Selektion auf der Ebene des Phänotyps (stabilisierende Selektion) aus dem Gen-Pool einer Population entfernt werden. Vielmehr weist das Genom selbst Anpassungen auf, die den Anteil negativer Mutationen an der allgemeinen Mutationsrate verringern. Dieser "Filter" ist gleichsam der stabilisierenden Selektion vorgeschaltet.
Zum anderen senkt der optimierte "Outcome" die relative Häufigkeit schädlicher Mutationen in vulnerablen Bereichen. Damit sind vorteilhafte Mutationen im Gesamtgenom proportional häufiger als bei einer funktionsunabhängigen Gleichverteilung der Mutationen. So können evolutionäre Anpassungen rascher entstehen als dies ohne "mutation bias" der Fall wäre. Wir sehen immer klarer: Das in der Evolution entstandene Genom ist ein komplexes System, das seine eigene, weitere Evolution beeinflusst.
Literatur
MONROE, J.G.; SRIKANT, T.; CARBONELL-BEJERANO, P. et al.: Mutation bias reflects natural selection in Arabidopsis thaliana. Nature (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-021-04269-6.
Autor: Martin Neukamm
